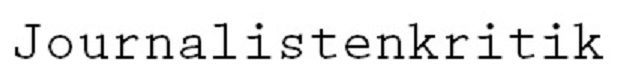Hintergrund
Die Mediengesellschaft und ihre Opfer – Grenzfälle journalistischer Ethik des frühen 21. Jahrhunderts
- Kapitel: Exkurs:
Bernd-Peter Arnold
„Das Interview als Verhör“ (Vorschlag: „Ein Interview ist kein Verhör“)
„Never forget, who the star of the interview is.“1 Der amerikanische Journalismusdozent John Brady benennt mit dieser Empfehlung ein zentrales Problem des Interviews als journalistischer Darstellungsform – auch und vor allem in Deutschland. Das Interview als wichtigste Dialogform ist nämlich ungeeignet für journalistische Selbstdarstellung. Es geht ausschließlich um die Gewinnung von Informationen aus einer authentischen Quelle. Dabei kann es um Sachinformationen zu einem Thema gehen, um die Meinung des Interviewten oder um Informationen zur Person des Gesprächspartners. Der Interviewer ist Vermittler, der durch Fragen Informationen gewinnt, der diese aber weder selbst gibt, noch bewertet.
Im Folgenden geht es um Interviews in Radio oder Fernsehen, also um „gesprochene“ Interviews, das heißt, um die direkte Abbildung eines Dialogs. Interviews in gedruckten oder online-Medien sind dem gegenüber Konstrukte. Dies bedeutet, dass aus einem Gespräch ein Frage – Antwort – Spiel konstruiert wird. Deshalb ist es auch üblich, dass in diesen Fällen dem Interviewpartner das Interview zum Gegenlesen und zur Autorisierung vorgelegt wird.
Zurück zum Interview in Radio und Fernsehen. Es dient – wie gesagt – der Gewinnung authentischer Informationen. Dies ist im Zeitalter des Internets von noch größerer Bedeutung als zuvor. Insbesondere die Gefahr durch die sozialen Medien mit ihrer Fülle an nicht überprüfbaren Informationen, die zum Teil aus dubiosen Quellen stammen und den Adressaten mit durch Algorithmen gesteuerten Informationen manipulieren, macht das Interview als originäre Informationsform immer wichtiger. Die sozialen Medien gaukeln den Menschen vor, stets umfassend und aktuell informiert zu werden. Dabei übersehen Viele, dass sie weniger Sachinformationen als vielmehr persönliche Eindrücke, Erlebnisse und vor allem Bewertungen von Informationen erhalten, die die klassischen Medien generiert und auf die Agenda gesetzt haben. Die professionellen – journalistischen Medien liefern also letztlich die Basis für die sozialen Medien. Dies geschieht nicht zuletzt durch Interviews – vorausgesetzt, diese werden zur Informationsgewinnung benutzt und nicht zur Anklage von Gesprächspartnern oder zur Selbstdarstellung der Interviewer.
1Brady, John; „The craft of interviewing“; New York 1977 (Vintage Books) S.58
Umso bedauerlicher ist, dass viele journalistische Interviews oftmals elementare Grundsätze des Handwerks vermissen lassen, stattdessen aber zu Formen der Manipulation, der Meinungsmache und der journalistischen Selbstdarstellung verkommen. Diese sind vom ursprünglichen Ziel dieser journalistischen Darstellungsform weit entfernt.
Der amerikanische Medienforscher Neil Postman, stets konstruktiver Kritiker der Medien und des Journalismus, empfiehlt recherchierenden und interviewenden Journalisten: „Erkenntnis bedeutet nicht, dass man die richtigen Antworten hat. Erkenntnis heißt nur, dass man die richtigen Fragen stellt.“2
Es ist erstaunlich, dass viele Interviewer ihre Rolle nicht als Fragesteller verstehen, sondern als Kommentatoren und oft sogar als Ankläger. Intelligente und kritische Fragen stellen und zuhören generiert Informationen. Ein falsches Rollenverständnis blockiert diese jedoch. Es wird nachfolgend von den Handwerksregeln für Interviewer die Rede sein. Diese zu beherrschen, ist in Zeiten hochprofessioneller Public-Relations-Aktivitäten, in denen Politiker und Manager systematisch auf Interviewsituationen vorbereitet werden, wichtiger als je zuvor. Wegen fehlender Professionalität oder aus falschem Verständnis der Funktion eines journalistischen Interviews schwanken Interviewer oft zwischen den Extremen „Mikrofonhalter“ und „Stichwortgeber“ einerseits und „Gegnerschaft“ sowie „Kommentator“ andererseits. Medien sind aber weder Werbeplattform noch Ersatzparlament oder gar Ersatzgericht.
Doch zunächst einige Beispiele, die zeigen, dass selbst „prominente“ Journalisten Probleme mit den Grundzügen des Handwerks haben – vermutlich aus einem falschen Verständnis ihrer Rolle als Interviewer.
Beispiel 1: am 26.3.2014 wurde der Vorstandsvorsitzende des Siemenskonzerns, Jo Kaeser, im ZDF – Heute Journal – interviewt (Interviewer: Claus Kleber)3. Kaeser war während der Krimkrise zu Wirtschaftsgesprächen nach Moskau gereist. Gefragt wurde er jedoch nicht nach dem Inhalt der Gespräche, sondern es ging dem Interviewer sehr stark darum, seine eigene politische Position darzustellen. Der frühere Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirrmacher, schrieb dazu am 28.3.2014 in dieser Zeitung: „Als
am Mittwochabend der deutsche Fernsehmoderator Claus Kleber über den Siemens-
2Postman, Neil; „Die zweite Aufklärung“; Berlin 2001 (2. Aufl. 2007) ( Berliner Taschenbuch-Verlag) S. 123
3ZDF Heute Journal am 26.3.2014
Vorstandsvorsitzenden Jo Kaeser wie ein Strafgericht hereinbrach, erlebte der Zuschauer eine Sternstunde der Selbstinszenierung des Journalismus. Unerbittlich nahm Kleber den
Mann in die Zange: Kaeser war, lange geplant, nach Moskau gefahren („Was haben Sie sich bei Ihrem Freundschaftsbesuch gedacht?“), er hat nicht nur Putin besucht („Wie lange mussten Sie warten?“), sondern auch den mit Einreiseverbot belegten Eisenbahnchef („Und Sie haben mit dem geredet!“) – und das alles, so Kleber, „als Repräsentant eines Unternehmens, das auch für Deutschland steht.“(…) Diese Inquisition, die auch in ihrem nur dem Remmidemmi verpflichteten Desinteresse daran, was Kaeser von Putin denn gehört haben könnte, alles in den Schatten stellt, was man an Vaterlandsverratsrhetorik aus dem wirklichen kalten Krieg kannte, ist überhaupt nur als Symptom journalistischen Übermenschentums diskutierbar und wird dadurch allerdings auch über den peinlichen Anlass hinaus interessant. Beharren auf einer normativen Deutung dessen, was die westlichen Sanktionen angeblich bedeuten, verwandelt Journalismus in Politik und das Fernsehstudio in einen Ort, wo der Interviewer plötzlich außenpolitische Bulletins abgibt: Claus Kleber zeigt der deutschen Wirtschaft die rote Linie auf. Die Deutschen sollten nicht erfahren, was Jo Kaeser in Moskau tat, sondern, wie Claus Kleber darüber denkt – ein Ereignis immerhin, von dem selbst die Bundesregierung noch lernen könnte, die am selben Tag mitteilte, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland weitergehen müsse.“4
Beispiel 2: Am 28.11.2013 wurde – ebenfalls im ZDF Heute Journal – der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel interviewt5. Gegenstand des von der Journalistin Marietta Slomka geführten Interviews war die Entscheidung der SPD-Spitze, ihre Mitglieder über die Bildung einer großen Koalition abstimmen zu lassen, zum ersten Mal in der Geschichte der Partei. Das Interview wurde zum Verhör. In bohrendem Ton wurde immer wieder dieselbe Frage gestellt: „Verträgt sich ein solches Votum mit unserer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie?“ Gabriel gab eine Antwort mit Begründung. Die Journalistin wiederholte mehrmals die Frage, um von Gabriel die Bestätigung ihrer offenbar abweichenden Meinung zu erhalten, die dieser – natürlich – nicht gab. Selbstverständlich kann man zu dem Thema eine abweichende Meinung haben. Diese gehört dann in einen journalistischen Kommentar, nicht aber in ein Interview. Der Informationsgewinn war übrigens im vorliegenden Fall extrem gering, weil durch die Selbstdarstellungsversuche der Journalistin sehr viel Sendezeit vergeudet wurde.
4 Schirrmacher, Frank; Frankfurter Allgemeine Zeitung Ausgabe 28.3.2014
5 ZDF Heute Journal am 28.11.2013
Beispiel 3: Am 12.7.2017 wurde – wiederum im ZDF Heute-Journal – die Schauspielerin Maria Furtwängler interviewt6. Es ging um eine Studie, die belegt, dass Frauen in den Medien unterrepräsentiert sind. Die Antworten der Schauspielerin entsprachen offensichtlich nicht den Vorstellungen des Journalisten Claus Kleber. Daraufhin kam es zu Unterstellungen, wie zum Beispiel, Maria Furtwängler wolle „das Publikum umerziehen“. Bemerkenswerter noch als der Verlauf des Interviews selbst sind die Reaktionen des Journalisten auf die öffentliche Kritik an seiner Interviewführung. Diese Reaktionen zeugen von einem fragwürdigen Verständnis der Rolle eines Interviewers. Einige Äußerungen im Wortlaut:7 „Sie war mir in der Sache weit überlegen.“ „Sie hat die Runde gewonnen.“ „Sie hat das Spiel hervorragend bestanden.“ „An dem Tag, an dem das Interview geführt wurde, war es allerdings schwierig, eine Gegenhaltung einzunehmen.“
Von einem problematischen Verständnis der Rolle eines Interviewers zeugen auch häufig Interviews, in denen Journalisten, wenn etwa ein Politiker nicht die gewünschten Antworten gibt, dieser mit den Aussagen anderer Politiker konfrontiert wird, quasi, um ihn zu „überführen“. Dass diese oft aggressiv vorgetragenen Anklageversuche dem Interviewten und nicht dem Interviewer „Punkte“ bringen, wird dabei unterschätzt. Zahlreiche Interviews mit Vertretern der AfD zeigen immer wieder, wie Journalisten mit dem Versuch, diese Partei um jeden Preis schlecht aussehen zu lassen, eher das Gegenteil bewirken. Beifall von Kollegen und politischen Freunden ersetzt aber nicht mangelnde Professionalität.
„Als Interviewer nehme ich die Gegenposition ein“ – so versuchen viele Journalisten ihr aggressives Verhalten zu rechtfertigen. Nein, man ist ein Dienstleister für Hörer und Zuschauer, für ein Publikum, das sich aus Personen mit unterschiedlichen Positionen und Meinungen zum jeweiligen Thema zusammensetzt. Dies bedeutet, dass man stellvertretend für dieses Publikum Fragen stellt. Ein Interview-Profi bezieht nicht die Gegenposition, sondern er konfrontiert den Interviewpartner mit anderen Positionen zum Thema – in Frageform. Journalisten führen in einer Radio- oder Fernsehsendung oft mehrere Interviews. Wird stets die gleiche Position vertreten, entsteht der Eindruck der Parteilichkeit. Zumindest
6 ZDF Heute Journal am 12.7.2017
7 Interview Deutschlandfunk, Sendung „Medias Res“ am 20.12.2017
beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist dies ein Verstoß gegen wichtige Grundsätze. Wechselt man aber die Position von Interview zu Interview, werden die Adressaten irritiert. Für Interviewer sollte ein Grundsatz gelten, den der langjährige Moderator der ARD-Tagesthemen, Hans-Joachim Friedrichs, immer wieder vertreten hat, in Diskussionen, Seminaren und Sendungen: „Ein Journalist sollte sich niemals mit einer Sache gemein machen – auch nicht mit einer guten.“
„Ich war nicht auf Augenhöhe mit Frau Furtwängler“ – das oben beschriebene Interview dokumentiert eine problematische Grundeinstellung. Selbstverständlich bereitet sich ein Interviewer auf ein Gespräch vor. Aber bringt ihn dies auf Augenhöhe mit dem Interviewpartner? Fünf Interviews in einer Sendung – fünfmal auf Augenhöhe mit Fachleuten? Dies wäre wohl eine bemerkenswerte Selbstüberschätzung und kann nur schiefgehen. Die Folgen sind aggressive Unterstellungen und unzulässige Kommentare. Der amerikanische Journalismusdozent Lawrence Grobel schreibt in diesem Zusammenhang: „man erwartet von Ihnen als Journalist doch nicht, dass Sie von dem Thema ebenso viel wissen wie der Interviewpartner. Wenn das so wäre, brauchten Sie doch kein Interview zu führen.“8
Es geht um die Gewinnung authentischer Informationen und nicht um Selbstdarstellung von Journalisten. Auch hier sei noch einmal an die Formulierung von Neil Postman erinnert: „Erkenntnis bedeutet nicht, dass man die richtigen Antworten hat. Erkenntnis heißt nur, dass man die richtigen Fragen stellt.“9
Interviewen ist ein wesentlicher Teil des journalistischen Handwerks. Umso erstaunlicher ist, wie oft selbst einfache Handwerksregeln nicht beherrscht werden. Elementar ist die Unterscheidung der verschiedenen Fragearten. Einige wenige Beispiele:10
Der Gebrauch von „offener“ und „geschlossener“ Frage ist von ausschlaggebender Bedeutung für die Struktur und das Zeitmanagement eines Interviews. Die offene Frage an einen Politiker „Wie beurteilen Sie die Politik des neuen amerikanischen Präsidenten?“ kann zu Beginn eines Interviews gestellt werden, da man mit einer längeren Antwort rechnen muss. Am Schluss eines Interviews gestellt, bringt die offene Frage unter Umständen das
8 Grobel, Lawrence; „The Art of the Interview“; New York 2004, (Three Rivers Press)
- 132 Übersetzung durch den Verfasser
9 Postman, Neil; a.a.O. S. 123
10 Arnold, Bernd-Peter; „ABC des Hörfunks“; Konstanz 1999 (UVK) S.190 ff.
Arnold, Bernd-Peter: „Nachrichten – Schlüssel zu aller Information“; Baden-Baden 2016
(Nomos) S. 155
Zeitmanagement in Gefahr. Eine geschlossene Frage, wie zum Beispiel „Werden Sie morgen nach Washington reisen?“ eignet sich demgegenüber besser für den Schluss eines Interviews, weil man im Zweifel mit einer „Ja“- oder „Nein“-Antwort rechnen kann. Verstöße gegen diese einfache Regel sind leider journalistischer Alltag.
Noch problematischer ist die Bündelung von Fragen. Es scheint eine sehr deutsche Unsitte zu sein, mehrere Fragen zusammen zu stellen. Dieses Verfahren macht es dem Interviewten sehr leicht. Man sucht sich die angenehmste Frage aus und beantwortet diese ausführlich. Die Adressaten und oft auch der Interviewer vergessen die übrigen Fragen, und dem Gesprächspartner bleiben möglicherweise unangenehme Antworten erspart. Interviewer in England, den USA und Kanada bündeln normalerweise keine Fragen. Sie fragen knapp, oft in einem Satz, sodass jeder weiß, was gefragt wurde und man bemerkt, wenn nicht oder ausweichend geantwortet wird. So werden kritische Interviews geführt, uneitel, souverän, auf das einzig wichtige Ziel gerichtet: Informationen für Hörer und Zuschauer zu gewinnen.
Tabu ist ein Fragetyp, der gleichwohl in Interviews auftaucht: die Suggestivfrage, eine Frage also, die mit Unterstellungen arbeitet. Sie bringt den Interviewpartner – wenn er nicht berechtigterweise die Antwort verweigert – in die Position eines Angeklagten, der sich verteidigen muss. Die (fiktive) Frage: „ Prügeln Sie Ihre Frau immer noch?“ darf nicht gestellt und muss natürlich nicht beantwortet werden. Sie unterstellt, dass der Gefragte seine Frau mindestens einmal geprügelt hat. Die (ebenfalls fiktive) Frage: „Prügeln Sie gelegentlich Ihre Frau?“ ist (im entsprechenden Zusammenhang) erlaubt, da sie nichts unterstellt. Nahezu täglich kann man in Interviews Suggestivfragen hören. Sie bringen in der Regel keine wichtigen Informationen. In jedem Fall verderben sie aber die Gesprächsatmosphäre. Eine gute Atmosphäre bietet aber größere Chancen, Informationen zu gewinnen.
Distanz halten zum Gesprächspartner ist eine weitere Grundregel. Der Interviewer ist weder Kumpel noch Gegner.
Zur professionellen Interviewführung gehört auch das Zuhören. „Silence ist golden as an interviewing technique.“ („Schweigen ist Gold als Interviewtechnik)11 empfiehlt John Brady in seinem Lehrbuch. Zuhören, eine Antwort auch einmal stehen lassen. Dem Interviewpartner Gelegenheit geben, nachzudenken und sich eine Antwort zu überlegen – dies alles fällt Journalisten oft schwer, geht aber naturgemäß auf Kosten der Information. Neil Postman beschreibt dieses Phänomen so: „Es liegt schon beinahe außerhalb der Grenzen des Erlaubten, in einer Fernsehsendung zu sagen: „Lassen Sie ich darüber nachdenken“, „Ich
11 Brady, John; a.a.O. S.83
weiß nicht“, „Was meinen Sie, wenn Sie sagen?“ oder „Aus welcher Quelle stammt diese Information?“. Diese Art von Diskurs verlangsamt nicht nur das Tempo, sie erzeugt auch den Eindruck von Unsicherheit und fehlendem Pfiff (…). Denken kommt auf dem Bildschirm nicht gut an. Es gibt dabei nicht viel zu sehen. Mit einem Wort: Denken ist keine darstellende Kunst.“12
Neben der Regel, dass Zuhören mehr Informationen bringt als journalistische Selbstdarstellung, gibt es natürlich auch Techniken für das Unterbrechen eines Interviewpartners – auch dabei zeigen sich bei nicht wenigen Journalisten Defizite. Unhöflich ins Wort fallen kommt beim Publikum nicht gut an. Die oft zu beobachtende Situation, dass Interviewer und Gesprächspartner gleichzeitig reden, führt dazu, dass keiner von beiden verstanden wird – ein technisches Phänomen, das zumindest Interviewer kennen sollten. Im Unterschied zum menschlichen Ohr kann nämlich ein Mikrofon nicht selektiv wahrnehmen. Die bewährte Regel, dass ein Interviewer den Gesprächspartner am geschicktesten unterbricht, indem er den gerade begonnenen Satz des Gegenübers aufnimmt und diesen seinerseits fortführt und so wieder das Wort gewinnt, gehört erstaunlicherweise bei vielen Journalisten nicht zum Instrumentarium.
Es wurde bereits dargestellt, dass Radio- und Fernsehjournalisten in England, in den USA und in Kanada sehr kritische Interviews führen, die in der Regel einen beträchtlichen Informationsgewinn für den Zuhörer bringen. Die Interviewer halten sich aber gleichwohl an die Grundregeln von Neutralität, Distanz und Verzicht auf die Präsentation der eigenen Meinung. Unterstellungen und Werturteile, insbesondere das Nachkommentieren von Antworten sind tabu. Dies liegt zum einen am Journalismusverständnis in den angelsächsischen Ländern. Man versteht sich in erster Linie als Vermittler von Informationen – auch von unangenehmen Informationen auf der Basis gründlicher Recherche. Hintergrund und Einordnung gelten dort im Unterschied zu Deutschland mehr als der Kommentar oder der in Mode gekommene Begriff „Einschätzung“ zum Kaschieren von Meinung. Mit letzterem wird oft das Trennungsgebot zwischen Nachricht und Meinung umgangen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist dies bei kritischer Betrachtung sogar ein Verstoß gegen Rechtsnormen.
Es kommt aber beim Vergleich der Situation in den angelsächsischen Ländern und in Deutschland noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Es sind die unterschiedlichen bzw. nicht vorhandenen festgeschriebenen Regeln. Im Gegensatz zu den deutschen Rundfunkanstalten existieren in den Rundfunkorganisationen in England und Nordamerika nicht nur allgemein
12 Postman, Neil „Wir amüsieren uns zu Tode“ Frankfurt ,1985 (S.Fischer) S.113
formulierte Programmgrundsätze, sondern sehr konkrete Handlungsanweisungen für Journalisten. Diese werden nicht etwa als unzulässige Einschränkung der Pressefreiheit oder als Beschränkung des persönlichen Entfaltungsspielraums verstanden. Ganz im Gegenteil, hier geht es um professionelle Standards. Diese dienen der Qualitätssicherung, und sie sind wichtige Entscheidungshilfen für Journalisten in aktuellen Situationen. So werden sie auch von den Journalisten im täglichen Aktualitätsstress empfunden.
Im Zusammenhang mit dem Thema „Interview“ einige Beispiele aus den entsprechenden Regelwerken. Beim öffentlich-rechtlichen kanadischen Rundfunk CBC (Canadian Broadcasting Corporation) sind in den „Journalistic Standards and Practices“13 neben den Grundsätzen für die Arbeit der Organisation insgesamt auch bis ins Detail gehende Anleitungen für die journalistische Arbeit formuliert. Unter dem Stichwort „Integrity“ heißt es zum Beispiel: „Rundfunkjournalisten nutzen nicht ihre Macht, um ihre eigene Meinung zu präsentieren.“ Zum Thema „Interview“ heißt es, dass Interviewer nicht gegenüber dem einen Gesprächspartner kritisch, und einem anderen gegenüber konziliant sein dürfen. „Es ist wichtig, dass wir uns wegen unserer Glaubwürdigkeit jeglicher persönlicher Werturteile enthalten.“
Dieser Aspekt ist für das Gesamtthema von ausschlaggebender Bedeutung. Journalisten müssten sich stets – wenn sie aus falschem Rollenverständnis die Regeln des Handwerks vernachlässigen – darüber im Klaren sein, dass ihr Verhalten vom Publikum auf die Medienorganisation insgesamt und nicht auf den einzelnen Journalisten bezogen wird.
Noch detaillierter als beim kanadischen Rundfunk sind die Regeln bei der öffentlich-rechtlichen BBC (British Broadcasting Corporation)14. Zwei kurze Abschnitte aus dem Kapitel „Interviewing“: „BBC-Interviews sollen stilvoll und höflich sein. Sie können fordernd, kritisch, skeptisch, informiert und auf den Punkt gebracht sein – aber nicht parteiisch, unhöflich und emotional einer Seite der Argumentation zugewandt. Den Interviewpartnern soll eine faire Chance gegeben werden, ihre komplette Antwort auf die Fragen darzulegen.“ An anderer Stelle heißt es im BBC-Regelwerk: „Interviews dürfen herausfordernd sein, aber nicht aggressiv, einschüchternd oder barsch – selbst, wenn man sich provoziert fühlt. In
13 CBC-Radio Canada Journalistic Standards and Practices (2017); Übersetzung durch den
Verfasser
14 BBC- Producers Guidelines 4.Aufl. o.J. S.117 ff.; Übersetzung durch den Verfasser
einem gut geführten Interview betrachten die Hörer und Zuschauer den Interviewer als Jemanden, der in ihrem Auftrag arbeitet.“
Auffallend bei diesen verbindlichen Regeln ist der hohe Stellenwert des Stils, mit dem Interviewer Gesprächspartnern begegnen. Kritisch sein und kritisch fragen heißt eben nicht, sich unhöflich und aggressiv verhalten. Ein wirklich kritischer Journalist wird immer sachlich bleiben. Wie unkritisch viele jedoch sind, kann man leicht an den fehlenden Nachfragen erkennen. Steif von der Karteikarte oder vom Teleprompter abgelesene Fragen, eine nach der anderen, während der Antwort bereits den Blick auf die nächste notierte Frage gerichtet, kein aufmerksames Zuhören – wie sollen so kritische Nachfragen zum Thema entstehen? Stattdessen oft aggressives Wiederholen ein und derselben Frage im Ton eines Inquisitors. Dabei weiß der erfahrene Interviewer, dass eine Frage, die nach einmaligem Nachfragen nicht beantwortet wird, auch beim fünften Anlauf unbeantwortet bleibt. Journalisten haben zwar das Recht, Fragen zu stellen. Interviewpartner haben aber ihrerseits das Recht, nicht zu antworten oder Antworten zu geben, die den Interviewer nicht zufriedenstellen, ihn nicht in seiner vorgefassten Meinung bestätigen oder ihm nicht gefallen.
Bei der kritischen Beobachtung vieler Interviews im deutschen Radio und Fernsehen drängen sich einige Fragen auf: „Warum verstehen sich so viele Interviewer nicht als Dienstleister sondern als Selbstdarsteller?“ „Warum wird so häufig gegen grundsätzliche Handwerksregeln verstoßen?“ „Warum werden so selten wirklich kritische Fragen gestellt und stattdessen Behauptungen und Unterstellungen gebracht – in der falschen Erwartung einer Bestätigung?“ „Warum geht es wohl in der öffentlichen Diskussion über Interviews oft weniger um die Inhalte der Aussagen der Interviewten als vielmehr um das Verhalten der Interviewer?“ „Was sagen eigentlich die Verantwortlichen in den Rundfunkanstalten zu der geschilderten Situation, durch die ja das Image des jeweiligen Hauses durchaus leiden kann?“
Die wichtige journalistische Darstellungsform Interview dient – wie gesagt – der Gewinnung authentischer Informationen. Es dient nicht der Anklage oder der Überführung von „Tätern“. In diesem Sinne schlechte Interviews bringen Medienhäuser, aber auch den Journalismus insgesamt, in Misskredit. Um die Verbesserung der Medienqualität und des Ansehens von Journalisten bemüht sich seit einigen Jahren eine Expertengruppe um den Nachrichtenchef des dänischen Rundfunks Ulrik Haagerup. Unter dem Motto „Constructive News“ erarbeitet die Gruppe Methoden zur Verbesserung der Qualität im Journalismus. Dabei geht es nicht ausschließlich um Nachrichten im engeren Sinne, sondern um den Informationsjournalismus generell. Die Gruppe betont, dass sie nicht für einen Journalismus eintritt, der Negatives schön redet, Kritik auslässt und Interviews zu Public-Relations-Auftritten verkommen lässt. Es geht lediglich um mehr Nachdenklichkeit und Selbstkritik bei denen, die oft aus reiner Gewohnheit willig dem journalistischen Mainstream folgen. Unter der Überschrift „Der Weg vom traditionellen Journalismus zu Constructive News“ schreibt Ulrik Haagerup: „Nicht mehr, sondern besser. Nicht negativ, sondern kritisch. Nicht aufgebracht, sondern wissbegierig. Nicht anklagend, sondern ermutigend. Nicht schreierisch, sondern neugierig. Nicht populistisch, sondern populär. Nicht stumpfsinnig, sondern modern. Nicht anklagend, sondern offen. Nicht nur nach dem üblichen wo?, wer? und wann? fragend, sondern auch nach dem wie? und was nun?“15
So können zeitgemäße journalistische Standards entstehen. Sie könnten auch eine Antwort auf die Gefahren der Manipulation der sozialen Medien sein. Auf jeden Fall können sie aber zur Verbesserung der Qualität von Interviews in Radio und Fernsehen beitragen. Bessere Interviews könnten ihre wichtige Rolle in einem zukunftsorientierten Journalismus wahrnehmen, nämlich die Funktion der Einordnung von Fakten und der Erläuterung von Hintergründen. Wiederholt wurde dargelegt, dass das Ziel eines Interviews die Gewinnung authentischer Informationen ist, Sachinformationen, Informationen über die Meinung des Interviewpartners zu einem Thema oder Information zur Person selbst. Informationen gewinnt man, wie gesagt, durch professionelles Fragen. Es kommt aber noch ein von vielen Journalisten unterschätzter Faktor hinzu: das Vertrauen des Interviewpartners. Man kann leicht im täglichen Umgang mit Menschen feststellen, dass man von Personen, deren Vertrauen man genießt, mehr erfährt. Die erwähnten Regeln aus den „BBC Producers Guidelines“ fordern ja auch ein Verhalten, das Vertrauen erzeugt. Ein Gesprächspartner, der aggressiv, unfreundlich, unhöflich, fordernd oder unterstellend angegangen wird, sagt weniger, als er weiß, hält sich zurück, schweigt gegebenenfalls. Man fragt sich, warum manche Radio- und Fernsehjournalisten auf solche doch einfachen und einleuchtenden Dinge nicht achten. Das Thema „Vertrauen bringt mehr Informationen“ ist auch Gegenstand von drei in der Anlage sehr unterschiedlichen amerikanischen Interview-Lehrbüchern für Journalisten, die längst zu „Klassikern“ geworden sind. Drei Zitate zur Verdeutlichung:
Lawrence Grobel: „Wenn man nicht das Vertrauen des Interviewpartners gewinnt, bekommt man nur die üblichen Allgemeinplätze als Antworten. Und: möglicherweise kein Interview mehr“.16
15 Haagerup, Ulrik; „Constructive News“ Salzburg 2015 (Verlag Oberauer) S. 141
16 Grobel, Lawrence; a.a.O S. 130; Übersetzung durch den Verfasser
Joan Clayton: „Nach einem Interview ist es besser, dass einen der Gesprächspartner für eine nette Person hält als wenn er das Gefühl hat, durch eine Waschmaschine gedreht worden zu sein.“ 17
John Brady: „Interviewen ist die Wissenschaft, erst Vertrauen zu gewinnen und dann Informationen.“ 18
Sicherlich bedarf – dies wurde aufgezeigt – das System der Interviews in Radio und Fernsehen in Deutschland der Verbesserung und der Korrekturen. Zwei Wege kommen dafür in Frage. Zum einen fehlt es an verbindlichen Regeln. Deren Einführung etwa nach angelsächsischem Vorbild hätte allerdings die hohe Hürde des hiesigen journalistischen Selbstverständnisses zu überwinden. Dieses ist aber stärker von Kritik und Meinung geprägt als vom Streben nach Informationsvermittlung. In einem anderen Bereich wären Verbesserungen indes leichter umzusetzen. Die Ausbildung von Radio- und Fernsehjournalisten könnte und sollte sich stärker dem Thema „Interview“ widmen.
17 Clayton, Joan; „Interviewing for Journalists; London (1994) (Piatkus Publishers) S. 150;
Übersetzung durch den Verfasser
18 Brady, John; a.a.O S.68; Übersetzung durch den Verfasser.
Quellenverzeichnis:
– Arnold, Bernd-Peter , „ABC des Hörfunks“, Konstanz 1999 (UVK)
– Arnold, Bernd-Peter , „Nachrichten – Schlüssel zu aller Information“
Baden-Baden 2016 (Nomos)
– Brady, John , „The Craft of Interviewing“, New York 1977 (Vintage Books)
– Clayton, Joan, “Interviewing for Journalists” , London 1994 (Piatkus Publishers)
– Grobel, Lawrence, “The Art of the Interview”, New York 2004 (Three Rivers Press)
– Haagerup, Ulrik, “Constructive News”, Salzburg 2015 (Verlag Oberauer)
– Postman, Neil, “Wir amüsieren uns zu Tode” Frankfurt 1985 (S. Fischer)
– Postman, Neil, „Die zweite Aufklärung“ Berlin 2007 (Berliner Taschenbuchverlag)
– Schirrmacher, Frank, „Dr. Seltsam ist heute online“ Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 28.3.2014, S. 11
– Deutschlandfunk „Medias Res“ vom 20.12.2017
– Zweites Deutsches Fernsehen, Heute-Journal vom 28.11.2013
– Zweites Deutsches Fernsehen, Heute-Journal vom 26.3.2014
– Zweites Deutsches Fernsehen, Heute Journal vom 12.7.2017
– CBC-Radio Canada Journalistic Standards and Practices, Toronto 2017.
– BBC-Producers Guidelines, 4. Auflage (London o.J.)